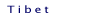 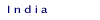 |
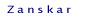 |
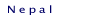 |
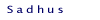 |
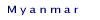
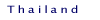
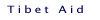

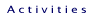
Zanskar-Trekking |
|
 |
 |
Die
Sinne stumpfen ab - allmählich verblasst das mächtige
Bergpanorama, wird der schneidende Wind bedeutungslos. Das Dröhnen
des reißenden Gebirgsbaches ist weit in die Ferne gerückt.
Die Außenwelt betäubt, der Körper steigt wie in
einem Trancezustand den steilen Geröllhang hinauf. Ich werde
zum außen stehenden Beobachter, höre tief ins Innere.
Verfolge den Kampf der Atmung, ständig bemüht, den Körper
mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen. Doch Vergebens, das hochfrequente
Hecheln ist auf dieser Höhe mit einem Hundertmeterlauf, bei
dem der Athlet durch einen Schnorchel atmet, vergleichbar. Dumpf
pocht das Herz, lässt jeden Schlag bis unter den Kehlkopf hämmern.
Kein Zweifel, die Nadel bewegt sich im roten Bereich, wir steigen
viel zu schnell. "Kommt, nur noch 15 Minuten zur Passhöhe",
ruft Sonam, der ladakhische Scout. Mit raschen Schritten klettert
er weiter, erinnert er uns daran, dass er die 28 Jahre seines Lebens
nie unterhalb der 3000-Metermarke verbracht hat. Der Höhenmesser
meldet 4820 Meter. Noch 300 quälende Höhenmeter bis zum
Ziel Shingo La, dem höchsten Pass unseres Treks durch Zanskar.
Oben angekommen, rückt langsam wieder die Schönheit der
Umgebung ins Zentrum meiner Wahrnehmung. In den smaragdgrün
schimmernden Gletscherseen spiegeln sich die umliegenden Sechstausender
wider. Von mächtigen Bergrücken umrahmt stehen wir auf
5100 Metern und blicken in das liebliche Tal durch das wir die nächsten
vier Tage bis Darcha wandern werden. |
|
Gebetsfahnen
flattern im Wind. Wie ein Wollknäuel spinnen sich die Leinen
mit hunderten bunter Tücher um einen Steinhaufen. Dazwischen
haben Einheimische geweihte Schiefertafeln mit der Inschrift Om
Mani Padme Hum als Opfergaben aufgereiht. Sonam legt ehrfürchtig
einen Stein auf den kleinen Hügel. Die Götter sollen milde
gestimmt werden, die Reisenden beim Abstieg vor Schaden bewahren.
Auch auf das Karma und damit eine günstige Wiedergeburt wirken
sich in Sonams Glauben diese rituellen Handlungen positiv aus. Denn
der Wind wird beim Durchstreifen der Gebetsfahnen unentwegt die
heiligen Mantras freisetzen und diese als Segen in die Täler
senden. Das Erreichen des Shingo La bedeutet für uns aber auch langsames Abschied nehmen von Zanskar, dem letzten Juwel im westlichen Himalaya. Zanskar hütet seine Geheimnisse. Nur sieben Monate im Jahr ist die indische Provinz zugänglich. Dann siegt die Natur. Während des rauhen Winters bietet nur der gefrorene Gebirgsfluss einen letzten Zugang, ist die Bevölkerung fast völlig abgeschnitten von der Außenwelt. Diese Isolation ermöglicht es Reisenden, noch unverfälschte Riten lamaistischer Kultur fernab ausgetretener Trekkingpfade zu erleben. |
 |
In
Kargil, einem kleinen, verlausten Nest, das als ladakhisch-kaschmirische
Grenzstadt im Kaschmirkonflikt einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangte,
beginnt die Reise ins verborgene Zanskar. Zwei Tage dauert die Jeepfahrt
auf der erst 1978 fertiggestellten Schotterpiste. Sie führt
durch das muslimische Surutal auf das von Buddhisten bewohnte Hochplateau
von Rangdum, der ethnischen Grenze Zanskars. Weiter über den
4400 Meter hohen Pensi-La Pass, der geografisch das offizielle Tor
zum ehemaligen Königreich ist. Der Weg schlängelt sich
vorbei an einem der längsten Gletscher des Himalaya, dem Durung-Drung.
Langsam wandelt sich die Natur, ändert ihr Farbenspiel. Graue,
schneebedeckte Bergriesen werden abgelöst von einer in Ockertönen
leuchtenden Hochwüste. Angekommen in Padum, schlagen wir unsere
Zelte in der zanskarischen Hauptstadt auf. Doch wer hier eine Metropole
pulsierenden Lebens erwartet, wird schnell vom Gegenteil überzeugt.
700 Seelen und eine Kompanie indischer Soldaten beherbergt die Hauptstadt.
Am Schnittpunkt von drei Tälern gelegen ist sie ein idealer
Ausgangspunkt für Ausflüge zu den malerisch sich an die
Talflanken schmiegenden Klöster Karsha und Tongde. Der Hausberg,
dient als perfekte Teststrecke zur Überprüfung der verbliebenen
Kondition. Auf 3600 Metern fühlen wir uns trotz des deutlich
niedrigeren Sauerstoffpartialdrucks noch recht stark. Doch beim
ersten Aufstieg tauchen unerwartete Probleme auf: das indische Essen
und seine durchschlagende Wirkung für zarte Europäermägen.
Auf 4200 Meter zollen wir dem Tribut. Bedrückt steigen wir
ab, wohl wissend, dass wir uns für die bevorstehenden Strapazen
schnell erholen müssen. |
|
Die
Tour startet schließlich nach drei Tagen in eine unwirtliche,
wüstenhafte Mondlandschaft. Kein Baum, nur vereinzelt ein paar
Dornensträucher. Tagelang trekken wir unter glühender
Sonne ohne Chance auf Schatten. Zanskar zeigt sein wahres Gesicht
und der Sunblocker wird nunmehr stündlich auf die ausgetrocknete,
spröde Haut aufgetragen. Eine Woche lang wird sich das Landschaftsbild
kaum ändern, werden wir unermüdlich durch ein enges Flusstal
wandern. Riesige Wände brauner Gesteinsschichten, aufgetürmt durch die gewaltigen Reibungskräfte der Kontinentalplatten, ragen steil an den Ufern empor. Eine bizarr geformte Skulpturenlandschaft glitzert rötlich im Sonnenlicht. Gesteinsformationen, die dem amerikanischen Bryce Canyon entliehen zu sein scheinen, erheben sich wie Orgelpfeifen. |
 |
Der
langsame Marsch auf engen, rutschigen und immer wieder in die Tiefe
abbrechenden Geröllpfaden erfordert neben der starken körperlichen
Anstrengung auch hohe Konzentration. Was gäben wir jetzt um
ein Bad im kühlen Bergfluss, der seit dem ersten Tag unser
ständiger Begleiter ist. Doch das Grollen dieser unbändigen
Wassermassen, die tonnenweise Sedimente mit sich reißen, lässt
bei näherer Betrachtung keine Zweifel offen, dass dies unmöglich
ist. Nach drei Tagen taucht hinter einer Flussbiegung unvermittelt eine grüne Oase auf. Wir sind in Surle, einer Ansiedlung, die lediglich aus zwei kleinen Lehmhäusern besteht. Auf den Flachdächern flattern Gebetsfahnen. Doch der Wind setzt wohl nicht nur Mantras frei. Der strenge Geruch des auf dem Dach zum Trocknen ausgebreiteten Yakdungs verbreitet eine ländlich-deftige Atmosphäre. Welch ein Glück, dass wenigstens eine Familie zu Hause ist. Im Schatten eines Pappelhains arbeitet Pema zusammen mit ihrer älteren Schwester Dölma. Mühsam zerkleinern sie weiße Kalksteine. Es sei an der Zeit, den Tschörten vor ihrem Haus zu restaurieren, erzählt uns Pema. Im Sommer hilft die ganze Familie mit, das sakrale Bauwerk in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Unterstützt werden sie dabei von Spenden Durchreisender. Die siebzehnjährige Pema erzählt, dass Sie nicht mehr im Haus der Familie wohne. Sie ist Nonne und lebt bereits seit neun Jahren in der benachbarten Frauengompa. Anders als ihre männlichen Kollegen würden sie jedoch ihren Familien tagsüber bei der schweren Feldarbeit helfen. Schließlich sind die Zanskaris noch echte Selbstversorger. Nur Kleinigkeiten werden auf dem Markt von Padum hinzugekauft oder getauscht. Ein filigran verzweigtes System künstlicher Bewässerung lässt selbst hier auf 3700 Metern den Anbau von Gerste, Getreide und sogar etwas Gemüse zu. Pemas Großmutter stampft bereits im Ndonmo, einem hölzernen Zylinder, den Buttertee. Ohne eine kräftige Stärkung lässt sie uns nicht weiterziehen, denn sie weiß genau, was uns noch bevorsteht. Immer wieder müssen wir Ausläufer des mächtigen Zanskarflusses auf abenteuerlichen Brückenkonstruktionen überqueren. Flache Steinplatten liegen lose auf zwei Baumstämmen, die die Ufer miteinander verbinden. Bei jedem Schritt verändert sich die Lage dieses Gesamtkunstwerkes und nur der Gedanke, dass unsere Ponys es auch geschafft haben, hilft uns, diese Herausforderung anzunehmen. Schon nach wenigen Tagen sollen wir eines Besseren belehrt werden. Ein Pony rutscht auf einer besonders halsbrecherischen Brücke aus, stolpert, stürzt und fällt mit zwei Seesäcken in den Fluss. Während sich der Schimmel aus dem Wasser retten kann, treibt unser Gepäck bereits mehrere hundert Meter flussabwärts im wütenden Strom. Erst Stunden danach erfahren wir von diesem Unfall. Bei der Mittagspause holen uns die Pferde ein und der Koch berichtet nervös über die Vorkommnisse. Wen hat das Schicksal getroffen? Katharina, die als einzige Frau unverzichtbare Utensilien mit sich führt? Rainer, der eine neue homöopathische Apotheke sein Eigen nennt? Markus, der nicht nur seine Steigeisen vermissen wird? Oder mich und damit das gesamte Fotomaterial der vergangenen beiden Wochen? Nach der Inspektion der beiden verbliebenen Seesäcke steht es fest: Katharina und Rainer sind die Leidtragenden. Außer den Kleidern am Leib und der Kamera im Tagesrucksack ist in Bruchteilen von Sekunden die gesamte Ausrüstung buchstäblich abgetaucht. Der asiatische Stolz würde es jedoch niemals zulassen, diese ausweglose Lage einfach zu akzeptieren. So berichtet der Ponyman, dass Sonam und Küchenhelfer Lolo, die roten Säcke immer im Visier, die rutschigen Wege oberhalb des Flusses zurückgegangen sind. Mit einem unguten Gefühl im Magen steuern wir den nächsten Lagerplatz an, um noch bei Tageslicht die Zelte auf zu bauen. Insgeheim machen wir uns mit der Tatsache vertraut, dass für Katharina und Rainer die nächsten zwölf Tage kein Wäschewechsel mehr möglich sein wird und die Nächte ohne Isomatte und Schlafsack extrem ungemütlich werden. Stunde um Stunde vergeht und wir wissen nicht, ob wir uns mehr Sorgen um das Gepäck oder unsere Gefährten machen sollen. Spät am Abend endlich die erlösende Nachricht. Die Seesäcke sind zwar bis in die kleinsten Winkel durchnässt, unsere Helfer dafür aber wohlauf und glücklich, unsere Habseligkeiten wieder besorgt zu haben. Zur Feier des Tages zieht der Koch nochmals alle Register seines Könnens. Es zischt, brodelt, dampft und brutzelt. Von wegen Höhenkrankheit und Appetitlosigkeit: Nach dieser schweißtreibenden und nervenaufreibenden Tagesetappe sind wir völlig ausgezehrt und freuen uns auf die Köstlichkeiten des Maître der indischen Küche. |
|
Zwei
verbeulte Blechtöpfe stehen auf kleinen Benzinkochern, die
immer wieder durch "Pumpen" zum Heizen animiert werden
müssen. Zum Aufwärmen nach der allabendlichen Katzenwäsche
im eisigen Gebirgswasser, gibt es erst einmal eine heiße Suppe.
Schlürfend wird alles aufgegessen und die Schälchen werden
für den zweiten Gang durch große Teller ersetzt. Reis,
Gemüse, Currys, indischer Hüttenkäse aus der Dose
und das bei keiner Mahlzeit fehlende Chapati bestimmen den Hauptgang
unserer vegetarischen Trekkerkost. Als Krönung gibt es einen
aus Wasser, Milch- und Puddingpulver gezauberten Nachtisch mit frischen
Mangos. Ob die Vorräte für die gesamt Tour ausreichen
werden? Unterwegs gibt es keinerlei Möglichkeiten, Nachschub
zu kaufen. Eine Gruppe, die uns entgegen kommt, führt sogar
Fleischvorräte mit sich. Gackernde, auf Ponys transportierte
Hühner, die morgens noch auf dem Zeltplatz ein paar Körner
aufpicken, landen abends als Chicken-Curry auf den Tellern. Dann
doch lieber zwei Wochen vegetarisch. |
 |
Das
Seitental des Lingti-Flusses beherbergt eine der beeindruckendsten
Klosteranlagen des Himalaya. Die Sakralbauten des Klosters Phuktal
kleben wie Schwalbennester an einer steil abfallenden Felswand.
Schwerkraft und Statik scheinen außer Kraft gesetzt. Im Dukhang,
dem Versammlungssaal des Klosters halten in karmesinfarbene Gewänder
gehüllte Mönche eine Puja ab. Mit sonorer Stimme rezitieren
sie in schleppendem Rhythmus die Mantras der buddhistischen Schriftensammlung
Kanjur. Noch ehe wir uns an eines der niedrigen Tischchen gesetzt
haben, werden Tassen für den Buttertee gereicht. Novizen schleppen
das dampfende Fettgemisch in alten Kupferkannen herbei. Genüsslich
schlürfen die Mönche den Tee während der Gebetspausen.
Für unsere Geschmacksnerven stellt dieses aus Butter, Wasser,
Salz und Tee stundenlang aufgekochte Gebräu immer wieder eine
Herausforderung dar. Viel vertrauter auch für den europäischen
Geschmack sind da die alten Rollbilder und Wandmalereien - Zeugen
der Geschichte einer seit dem achten Jahrhundert in Zanskar lebendigen
lamaistischen Klosterkultur. Bildnisse des Reformers Tsonkhapa verraten,
dass der Mönchsorden zur Gelugpaschule gehört. Diese -
auch als Gelbmützensekte - bekannte Richtung des tibetischen
Buddhismus konzentriert sich auf den Ursprung der Lehre und unterliegt
einem strengen Regelwerk. |
|
Von
Phuktal führt eine letzte Tagesetappe durch das enge Flusstal.
Immer wieder passieren wir lange Manimauern und zahlreiche Tschörten.
Am Abend endet die Mondlandschaft, bricht das Tal in die weitläufige
Hochebene von Kargyak auf. Die karge Wüste weicht satten Wiesen.
Weit hinauf, bis zu den Bergflanken sprießt saftiges Grün.
Ein Farbenmeer gelber, weißer und violetter Blüten ergießt
sich durch das Tal. Dazwischen wächst auch der für Zanskar
so berühmte blaue Mohn. Doch die Idylle trügt. Zu später
Stunde schwellen die Gebirgsbäche zu wilden Flüssen an.
Bei der Durchquerung heißt es, die Zähne zusammenbeißen.
Barfuss geht es durch vier Grad kaltes Wasser. Die Strömung
reißt große Steine mit sich, lässt sie über
die fast gefühllosen Füße schrammen. |
 |
Am
Gumburanjon, dem heiligen Berg Zanskars, treffen wir auf Viehhirten.
Während der Sommermonate leben sie in Zelten auf dem Hochplateau,
treiben ihre Herden zu den saftigsten Weiden. Gerade werden einem
Yak die Füße zusammengebunden. Ein verwegen aussehender
Zanskari mit sonnengegerbten Gesicht schneidet das Yakhaar bis auf
fünf Zentimeter Länge. Die Büschel werden an die
Frauen ins Zelt weitergereicht. Hier sitzen sie, schlagen und kämmen
das Haar, damit es sich zum Spinnen und Weben eignet. Archaisches
Leben, bestimmt vom Rhythmus der Natur. Noch das Letzte wird ihr
für die rauen Wintermonate abgerungen. Alles scheint nützlich
und verwertbar. Selbst während des Viehauftriebes spinnen die
Hirten Wolle, wickeln filigran die dünnen Fäden auf Holzstäbe.
Der Yakdung wird akribisch gesammelt, liefert er doch in getrockneter
Form das wichtigste Brennmaterial. Abends am Feuer erzählen sie sich Geschichten von einem verborgenen Land. Niemand von ihnen hat dieses mystische Reich je gesehen. Sie nennen es Shambala. Die Zanskaris erinnern uns dabei an unsere Suche. Es ist die Suche nach dem ursprünglichen Leben auf dem von Mythen geprägten Dach der Welt. Immer schneller hält die Moderne Einzug selbst in entlegene Gebirgsregionen. Doch Zanskar scheint hiervon unberührt, bleibt durch seine enklavenhafte Abgeschiedenheit eine der letzten Perlen des Himalaya. |
|
|
|
|